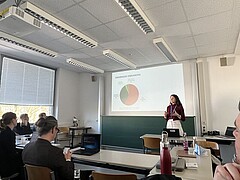Wie berichten journalistische Medien über Verschwörungstheorien und ihre Anhänger*innen? [03.04.25]
Ein Blick auf die Forschungsergebnisse von Natascha Hetzel auf der DGPuK 2025: Natascha Hetzel hatte die Gelegenheit, ihre Forschung zu der Frage, wie journalistische Medien über Verschwörungstheorien und ihre Anhänger*innen berichten, auf dem Panel Verschwörungserzählungen und Bedrohungswahrnehmungen auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) 2025 an der Freien Universität Berlin vorzustellen. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse:
1. Debunking-Leistung muss verbessert werden
Ein zentrales Ergebnis ihrer Forschung ist, dass die Debunking-Leistung journalistischer Medien noch verbessert werden muss. Ein erheblicher Teil der Berichterstattung zu Verschwörungstheorien gibt die Inhalte dieser Theorien wieder, ohne deren Wahrheitsgehalt einzuordnen.
2. Verschwörungstheorien und ihre Anhänger*innen werden als Gefahr geframed
Vor allem seit der Corona-Pandemie wird das von Verschwörungstheorien und ihren Anhänger*innen ausgehende Gefahrenpotential diskutiert. Dabei werden sowohl gesellschaftliche Folgen von Verschwörungstheorien sowie das von Verschwörungstheoretiker*innen ausgehende Gewaltpotential thematisiert. Als Handlungsoption wird häufig ein rechtstaatliches Vorgehen gegen Verschwörungstheorien und ihre Anhänger*innen, bspw. durch den Verfassungsschutz, vorgeschlagen.